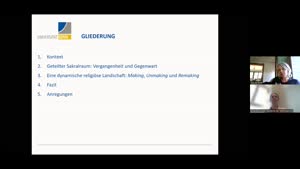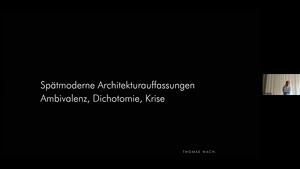Religiöse Architekturen als Spiegel und Gestalter pluraler Stadtgesellschaften - Dr. Anna Körs - Universität Hamburg
- Lecture2Go
- Videokatalog
- F.4 - Erziehungswissenschaft
- Erziehungswissenschaft
- Ringvorlesung AWR: Religiöse Architekturen in säkularen Stadtgesellschaften
Videokatalog

Video-Player wird geladen.
Aktueller Zeitpunkt 0:00
/
Dauer 41:14
Geladen: 0.24%
00:00
Streamtyp LIVE
Verbleibende Zeit -41:14
1x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, ausgewählt
- 0.75x
- Beschreibungen aus, ausgewählt
- Untertiteleinstellungen, öffnet Einstellungen für Untertitel
- Untertitel aus, ausgewählt
- Deutsch (automatisch erzeugt) Untertitel
- Quality
- 360p
- 540p
- 720p
- 1080p
- Auto, ausgewählt
- default, ausgewählt
This is a modal window.
Anfang des Dialogfensters. Esc bricht ab und schließt das Fenster.
Ende des Dialogfensters.
1646 Aufrufe
25.04.2022
Religiöse Architekturen als Spiegel und Gestalter pluraler Stadtgesellschaften
Religiöse Architekturen in sakulären Stadtgesellschaften
Koordination: Dr. Anna Körs / Prof. Dr. Giuseppe Veltri, beide Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg / Dr. Karen Körber / Dr. Alexandra Klei, beide Institut für die Geschichte der deutschen Juden
In den zurückliegenden zwei Jahrzehnten sind in Deutschland in verschiedenen Städten neue Synagogen geplant und gebaut worden. Zugleich hat die Zahl repräsentativer Moscheebauten zugenommen. Daneben entstehen kreative Projekte zu erweiterten Nutzungen oder Umnutzungen von leer stehenden Kirchengebäuden sowie Häuser der Religionen, die einer multireligiösen Stadtgesellschaft
sichtbaren Ausdruck verleihen wollen. Alle diese religiösen Architekturen sind materiale Zeichen einer gewachsenen religiösen Diversität in mehrheitlich säkularen urbanen Räumen, an denen sich mitunter konflikthafte Aushandlungsprozesse
um das Verhältnis zur Geschichte, das Recht auf Repräsentation und den Anspruch auf Zugehörigkeit entfalten. Die Ringvorlesung befasst sich anhand von Fallbeispielen mit den Dynamiken religiöser Architekturen in ihrem Verhältnis zu multireligiösen säkularen Stadtgesellschaften.
Die Ringvorlesung wird gefördert von der Udo Keller Stiftung Forum Humanum.
Mehr
Technischer Support
Bitte klicken Sie auf den nachfolgenden Link und füllen Sie daraufhin die notwendigen Felder aus, um unser Support-Team zu kontaktieren!
Link zu der RRZ-Support-Seite
Untertitel
00:00:00
Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen
00:00:06
und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Ringvorlesung,
00:00:11
religiöse Architekturen in säkularen Stadtgesellschaften. Mein Name ist Anna Körs,
00:00:18
ich bin wissenschaftliche Geschäftsführerin und Vizedirektorin der Akademie der Weltreligion,
00:00:24
der Universität Hamburg und begrüße Sie ebenso im Namen des Direktors professorisches Eppe Weltri.
00:00:32
Diese Ringvorlesung ist eine Kooperationsveranstaltung der Akademie mit dem Institut für
00:00:40
die Geschichte der Deutschen Juden und den dort tätigen Kolleginnen,
00:00:45
Dr. Karin Körber und Alexandra Doktor Alexandra Klei,
00:00:52
die sie beide in den folgenden Veranstaltungen hier an dieser Stelle
00:00:56
sicher auch noch sehen und kennenlernen werden.
00:01:00
Ich werde heute mit meinem Vortrag den Auftakt machen
00:01:05
und möchte vorab nur kurz ein paar allgemeine Anmerkungen machen.
00:01:09
Diese Ringvorlesung findet bekanntlich nochmals als digitale Ringvorlesung statt.
00:01:15
Wir hätten sie natürlich gerne als Präsenzveranstaltung angeboten,
00:01:18
was aber zum Zeitpunkt der Planung noch zu unsicher schien und nicht angeraten war.
00:01:24
Andererseits ermöglicht es vielleicht der einen oder dem anderen,
00:01:28
sich hier zuzuschalten, auch wenn sie hier nicht vor Ort sind.
00:01:32
Und es ermöglichte, uns auch Referierende etwa aus München oder
00:01:36
auch den USA zu gewinnen, was ansonsten schwieriger gewesen wäre.
00:01:41
Insofern freuen wir uns genauso auf eine digitale Ringvorlesung und hoffen Sie
00:01:45
im nächsten Semester dann auch wieder hier vor Ort in Hamburg begrüßen zu können.
00:01:50
Die Ringvorlesung besteht aus sechs Terminen und Sie sehen hier eingeblendet,
00:01:56
das Programm aus dem allgemeinen Vorlesungsverzeichnis,
00:02:00
dass Sie auch auf unserer Webseite finden, Studierende auch in Stine,
00:02:04
die mit ihrer Teilnahme hier auch einen Leistungspunkt erwerben können.
00:02:08
Die Vorträge der Ringvorlesung werden aufgezeichnet und dokumentiert auf der Medienplattform der Universität Hamburg.
00:02:15
Dort können Sie sich die Vorträge dann auch später noch als
00:02:18
Lecture to go ansehen. Diese erste Veranstaltung,
00:02:24
heute sehen Sie aus Termingründen ausnahmsweise als Aufzeichnung die weiteren Veranstaltungen werden ebenso digital,
00:02:33
dann aber live stattfinden,
00:02:35
sodass es im Anschluss an den Vortrag auch Gelegenheit gibt für
00:02:39
Fragen,
00:02:40
Anmerkungen und Austausch
00:02:42
Dazu wird ein Link zu einem Webinar verschickt werden,
00:02:46
den sie dann rechtzeitig per Mail bekommen, wenn sie sich angemeldet haben.
00:02:52
Heute wird es also kein Diskussionsteil geben,
00:02:55
aber sie können mir gerne Rückmeldung fragen,
00:02:57
Anmerkungen schicken an meine E-Mail-Adresse,
00:02:59
die werde ich am Ende einblenden und wir werden uns hier sicher auch wiedersehen,
00:03:04
sodass auch später Austausch möglich sein wird,
00:03:07
zumal ich in meinem Vortrag hier Dinge sicher antippen werde,
00:03:11
die dann in den Folgeveranstaltungen auch
00:03:14
noch weiter thematisiert werden
00:03:17
Schließlich möchte ich noch Dank aussprechen. Zunächst natürlich Ihnen für
00:03:20
Ihr Interesse und Ihre Teilnahme danken möchte ich den Kooperationspartnerin Karin Körber
00:03:26
und Alexandra Kley und allen weiteren Beteiligten beide Einrichtungen, die hierran organisatorisch mitwirken.
00:03:34
Ebenso Herrn Erfle vom Medienzentrum für die Technik und Aufzeichnung.
00:03:38
Besonders danken möchte ich auch der Udo-Keller-Stiftung-Forum Humanum, die diese,
00:03:44
wie auch viele vorherige Ringvorlesungen finanziell fördert und schließlich dank bereits vorab auch an die referierenden,
00:03:53
mit denen wir in den kommenden Wochen über die verschiedenen religiösen Architekturen,
00:03:58
Synagogen, Kirchen, Moscheen, Inter und multireligiöse Räume ins Gespräch kommen werden wird und worauf ich sehr gespannt bin.
00:04:08
Damit bin ich beim Thema und ich komme zu meinem Vortrag mit
00:04:17
dem Titel Religiöse Architekturen als Spiegel und Gestalter, pluraler Gesellschaften.
00:04:27
Ich werde hierzu in der Einleitung kurz eingehen auf gegenwärtige religiöse
00:04:35
Entwicklung in einerseits und den daraus resultierenden räumlichen Dynamiken im religiösen Feld, andererseits.
00:04:45
Von dort aus werde ich eine These formulieren,
00:04:48
die dann leitend sein wird für meine Perspektive auf religiöse Architekturen.
00:04:53
Und zwar im Kern, dass religiöse Architekturen nicht nur Spiegel,
00:04:58
sondern auch Gestalter pluraler Gesellschaften sind und dabei das Materielle eine wichtige Rolle spielt.
00:05:06
Diese These werde ich dann im Hauptteil versuchen,
00:05:09
auch empirisch zu belegen und werde Einblicke geben zu drei unterschiedlichen Raumtypen und zwar zu Citykirchen,
00:05:18
zu einer Kirchenmorschee, Umnutzung und zu einem sogenannten Haus der Religionen.
00:05:24
Und drittens werde ich diese drei Raumtypen versuchen zu systematisieren,
00:05:29
im Hinblick auf meine zentrale Fragestellung, nämlich wie wirken religiöse Architekturen in pluralen Stadtgesellschaften.
00:05:42
Wenn wir uns nun die Entwicklungen auf dem religiösen Feld der
00:05:48
letzten Jahrzehnte anschauen, dann hat, hier einmal plakativ dargestellt,
00:05:52
ein erheblicher Wandel stattgefunden
00:05:55
So gehörten im Jahr 1950 hier links zu sehen,
00:06:00
noch 96 Prozent der Bevölkerung,
00:06:02
einer der beiden großen christlichen Kirchen an und nur 4 Prozent waren
00:06:06
entweder ohne Konfession oder gehörten einer anderen Konfession oder Religion an.
00:06:13
Im Jahr 2010 rechts zu sehen ist der Anteil der evangelischen oder katholischen
00:06:18
Bevölkerung auf rund 60 Prozent gesunken, wohingegen der Rest,
00:06:23
der ehemals 4 Prozent sich auf einen Anteil von 40 Prozent verzehnfacht hat.
00:06:30
Davon 30 Prozent ohne Religionszögerigkeit und 10 Prozent mit einer
00:06:35
anderen Konfession oder Religion
00:06:38
Diese Daten sind nicht mehr ganz aktuell,
00:06:40
schreiben sich aber im Prinzip fort, laut Kirchen, eigenen Prognosen,
00:06:45
werden die beiden großen christlichen Kirchen bis 2060 nochmals fast die
00:06:49
Hälfte ihrer Mitglieder verlieren und der Anteil der Kirchenmitglieder an der Bevölkerung würde dann auf 29 Prozent sinken.
00:06:59
Wohingegen der Anteil etwa der Muslime inzwischen auf sechs bis sieben Prozent gestiegen ist.
00:07:08
Der Religionssoziologe Peter Berger spricht angesichts dieser parallelen Prozesse der Säkularisierung einerseits und der Pluralisierung andererseits von zwei Pluralisten,
00:07:18
oder wie ich es hier nenne, einer doppelten Pluralisierung,
00:07:22
die dazu führt, und das ist mein Ausgangspunkt,
00:07:25
das ist ein zunehmenden Bedarf der Gestaltung, der Aushandlung,
00:07:30
der Regulierung gibt, und zwar bezüglich der Beziehungen zwischen den Religionen,
00:07:36
wie auch Zwischenreligionen und Gesellschaft.
00:07:41
Wenn wir uns nun die räumlichen Entwicklungen des religiösen Feldes anschauen,
00:07:48
lassen sich mindestens drei Entwicklungen beobachten
00:07:52
Erstens prägen, Kirchengebäude seit Jahrhunderten, vieler Orts,
00:07:57
das Stadtbild, wie hier etwa die Kirchtürme in Hamburg und
00:08:01
gleichzeitig stehen die beiden großen christlichen Kirchen zunehmend vor der Herausforderung,
00:08:06
dass sie über mehr Gebäude verfügen,
00:08:08
als sie mit Leben füllen können.
00:08:10
Die Kirchen reagieren auf diese Prozesse der Säkularisierung einerseits durch Kirchenummnutzungen und Schließungen,
00:08:18
andererseits aber auch durch den Erhalt ihres symbolischen Kapitals.
00:08:23
Eine Strategie hierzu ist etwa die Reinszenierung ihrer Innenstadtkirchen Eis,
00:08:29
sogenannte Citykirchen, die programmatisch ihre Türen und Räume öffnen für BesucherInnen,
00:08:36
auch jenseits des Gemeindelebens.
00:08:39
Diese Citykirchen sind mein erster empirischer Fall,
00:08:42
auf den ich dann im zweiten Teil noch zu sprechen komme.
00:08:46
Zweitens entstehen durch die Pluralisierung zunehmend Räume auch nicht christlicher Minderheitsreligionen,
00:08:55
wie insbesondere Moscheen, aber auch Tempel, Goodvaras,
00:08:58
Chemhäuser und andere monoreligiöse Räume.
00:09:03
Im Zentrum des öffentlichen Bewusstseins stehen dabei zumeist repräsentative Neubauten oder
00:09:11
auch Wiederaufaufbauten, wie aktuell etwa die Bornplatz-Synagoge in Hamburg.
00:09:17
Faktisch handelt es sich allerdings bei den Gebetsräumen nicht christlicher Minderheiten zum allergrößten Teil,
00:09:24
um umfunktionierte Zweckräume wie Fabriken, Lager, Sporthallen,
00:09:28
Wohnhäuser, Tiefgaragen und so weiter.
00:09:32
So sind von den bundesweit 2020 Moscheen in Deutschland
00:09:37
beispielsweise nur zwölf Prozent überhaupt als solche erkennbar.
00:09:42
Für nicht-christliche Religionsgemeinschaften stellt sich somit das Verhältnis von Präsenz und
00:09:47
Repräsentation in umgekehrter Weise dar
00:09:51
Sie sind wesentlich präsenter, als sie im öffentlichen Raum sichtbar
00:09:54
und wahrnehmbar sind. Wenn wir bei diesen monoreligiösen Räumen,
00:10:01
also zwei gewissermaßen Gegenläufige Entwicklungen sehen, entstehen daneben,
00:10:07
drittens, zunehmend Inter- und multireligöse Räume. Einen speziellen Fall,
00:10:14
und dies ist mein zweiter, empirischer Fall,
00:10:16
stellt hierzu die Umnutzung einer Kirche in eine Moschee dar,
00:10:20
hier unten links zu sehen,
00:10:23
die interessanterweise als interreligiöser Raum gedeutet wurde
00:10:27
Daneben entstehen Hinter- oder multireligiöse Räume mit synchroner,
00:10:33
also gleichzeitiger Nutzung, verschiedene Religionsgemeinschaften. Bekannt sind Räume der Stille
00:10:39
innerhalb von öffentlichen Gebäuden wie Universitäten, Krankenhäusern oder Flughäfen.
00:10:45
Ein relativ neues Phänomen sind dagegen öffentlich sichtbare, interreligiöse Räume,
00:10:51
wie etwa gärtende Religionen, die in Köln oder auch anderen Städten entstanden sind.
00:10:57
Und zu beobachten ist schließlich, und dies ist mein dritter,
00:11:01
empirischer Fall, neuer Typus, religiöser Räume, und zwar ein interreligiöser Sakralbau,
00:11:07
wie er etwa in Berlin mit dem geplanten House of One entsteht.
00:11:12
Geschaffen werden soll damit eine Kirche,
00:11:14
eine Synagoge und eine Moschee unter einem Dach,
00:11:17
um dadurch Dialog und Toleranz zu fördern.
00:11:22
Deutlich wird gesellschaftliche Prozesse der religiösen Pluralisierung und Säkularisierung materialisieren sich
00:11:28
im Raum und religiöse Architekturen sind somit Ausdruck und Spiegel
00:11:34
der Sozialen und machen diese Entwicklungen sichtbar
00:11:39
Dabei kann das bauliche, dem Sozialen zeitlich hinterherhinken,
00:11:44
wenn einerseits Kirchen leer stehen, andererseits der wachsende Anteil,
00:11:48
religiöser Minderheiten, baulich kaum sichtbar wird.
00:11:52
Oder das bauliche kann auch in die Zukunft verweisen,
00:11:56
wenn etwa Häuser der Religion als architektonischer Ausdruck und zugleich Visionen
00:12:02
einer pluralen Gesellschaft gebaut werden.
00:12:06
Meine These ist nun, dass diese religiösen Architekturen insofern
00:12:14
einerseits Spiegel des Sozialen sind und die Transformation des religiösen Feldes
00:12:18
sichtbar machen.
00:12:19
Das haben wir
00:12:20
gerade gesehen
00:12:21
Dass sie andererseits aber, und dieses ist mein Fokus,
00:12:25
auch Gestalter des sozialen sind, indem sie Gulminationspunkte,
00:12:29
also zentrale Orte von Aushandlungsprozessen,
00:12:31
sowohl zwischen den Religionen als auch zwischen Religion und Gesellschaft sind.
00:12:37
Und dabei als Sozialmaterielle Konstellation handlungsorientierende Wirkkraft entfalten können.
00:12:45
Was ich ja so zeigen möchte, ist, erstens,
00:12:48
dass religiöse Architekturen nicht nur Ausdruck der Gesellschaft sind,
00:12:52
sondern auch in die Gesellschaft wirken und dass hierfür zweitens neben sozialen,
00:12:57
kulturellen,
00:12:57
diskursiven Prozessen,
00:12:59
insbesondere ihre Materialität bedeutsam ist
00:13:03
Damit komme ich zum zweiten empirischen Teil und den drei genannten Raumtypen,
00:13:09
die ich jeweils daraufhin anschauen werde,
00:13:13
wie und von wem diese Architekturen geschaffen werden,
00:13:16
welche Rolle dabei das materielle spielt und welche Wirkungen von ihnen ausgehen.
00:13:27
Mein erster Fall sind die sogenannten City-Kirchen,
00:13:32
City-Kirchen sind entstanden in den 1990er Jahren als angesichts
00:13:37
gesellschaftlicher Veränderungen und insbesondere des Rückgangs der Kirchenmitglieder,
00:13:42
neue Konzepte,
00:13:44
jenseits der traditionellen Ortsgemeinde benötigt wurden
00:13:48
In dieser Situation profilierten sich Innenstadtkirchen in einem zunehmend säkularisierten Stadtkontext als City-Kirchen,
00:13:57
indem sie sich durch niedrigschwellige Zugänge und Angebote als Orte der Stadt Öffentlichkeit präsentierten.
00:14:06
Mit dieser Reinszenierung, als öffentliche Räume sind City-Kirchen programmatisch,
00:14:11
darauf ausgerichtet die Grenze der Organisation Kirche relativ durchlässig werden
00:14:16
zu lassen und dadurch auch gerade diejenigen zu adressieren,
00:14:20
die dem kirchlichen Leben ansonsten eher fernstehen.
00:14:24
Sie wurden damit zum kirchlichen Instrumentarium, um,
00:14:29
so heißt es, in einem Papier,
00:14:31
der evangelischen Kirche, um gegen den Trend zu wachsen.
00:14:36
Die Frage ist, inwieweit funktioniert diese Selbstregulierung durch Profilierung oder empirisch gefragt,
00:14:45
welche Besucherkreise erreichen City-Kirchen tatsächlich und wie werden sie von diesen wahrgenommen?
00:14:52
Zwei Studien, die Sie hier sehen, sind hierzu aufschlussreich,
00:14:56
die auf quantitativen Befragungen von rund 1600 BesucherInnen in vier Stadtkirchen im Ostseeraum,
00:15:03
beziehungsweise von 6500 BesucherInnen in zwölf City-Kirchen in Deutschland und
00:15:09
der Schweiz
00:15:18
Beide Studien zeigen, übereinstimmen zunächst, dass diese Programmatik eine
00:15:23
größere Öffentlichkeit zu erreichen, auf den ersten Blick zur Gelingenscheid.
00:15:29
Denn diese Kirchen werden in vielfältiger Weise wahrgenommen als religiöse,
00:15:34
als geschichtliche, städtische, bauwerkliche,
00:15:36
atmosphärische Orte wie hier exemplarisch zu sehen aus der ersten Studie,
00:15:41
wie ebenso als Orte kollektiver Erinnerung und vor allem
00:15:44
auch als emotionale Orte
00:15:47
Auffällig ist dabei, dass unterschiedliche Besuchergruppen, Kirchengemeinde,
00:15:51
Stadtbewohner und Touristen, trotz großer Unterschiede im Nutzungsverhalten der Kirchen,
00:15:57
offenbar in sehr ähnlicher Weise diese wahrnehmen.
00:16:02
Dies gilt, selbst für die Touristen, wenn etwa vier,
00:16:05
fünfte von ihnen angeben, dass die Kirche positive Gefühle in ihnen hervorrufe,
00:16:09
obwohl sie das Gebäude häufig das erste Mal betreten.
00:16:15
Man könnte daher meinen, dass diese kollektiven Bedeutungszuschreibungen und Wahrnehmungen über die verschiedenen Besuchsgruppen hinweg,
00:16:23
vor allem der Wirkkraft des Raumes zuzurechnen sind.
00:16:28
Das Kirchengebäude also über eine Eigenwirkung, eine allgemeine Verständlichkeit verfügen würde.
00:16:33
Wie sonst kann es sein, dass City-Kirchen bei fast allen Besucher in ähnliche Reaktionen hervorrufen.
00:16:40
Diese Annahme trifft allerdings nur begrenzt zu und relativiert sich,
00:16:45
wenn man sich anschaut, wer die BesucherInnen und insbesondere die Touristinnen sind.
00:16:51
Denn beide Studien zeigen, ebenso übereinstimmt, dass die unterschiedlichen Besuchsgruppen
00:16:59
sich zwar in ihrem Nutzungsverhalten und auch hinsichtlich so zu demografischer Merkmale deutlich unterscheiden.
00:17:05
Gemeinsam ist aber allen drei Besuchsgruppen, wo du auch den Touristen,
00:17:08
dass sie über eine hohe Religiosität verfügen, vielfach regelmäßig,
00:17:12
Kirchen besuchen, mit dem Kirchenraum vertraut sind und sich religiös geprägt und orientiert verhalten.
00:17:18
Auch hierzu exemplarisch aus der zweiten Studie ein Blick auf die
00:17:21
Touristen, als die weitaus größte Besuchergruppe.
00:17:24
Zu sehen sind hier die BesucherInnen der zwölf City-Kirchen differenziert nach Religiositätstypen
00:17:31
Gefragt, wurde hierzu nach der religiösen Praxis,
00:17:34
zur religiösen Reflexion und Erfahrung, sie wie zur religiösen Prägung und Selbsteinstufung,
00:17:40
wonach sich sieben Typen unterscheiden lassen. Auf dem einen Pool,
00:17:45
ganz links, der Anteil der A-Religiösen,
00:17:48
mit den jeweils niedrigsten Werten bezogen auf die gemessene Religiosität,
00:17:54
auf dem anderen Pool die religiösen,
00:17:58
mit der mit in der Regel den höchsten werden und dazwischen in abgestufter Weise die anderen fünf Typen,
00:18:04
auf die ich jetzt nicht näher eingehe.
00:18:07
Worauf ich hinaus will, deutlich wird hier einerseits das Spektrum von A-Religiösen
00:18:13
bis hin zu hochreligiösen BesucherInnen, die von City-Kirchen offenbar angesprochen werden.
00:18:18
Andererseits ist der Anteil der A-Religiösen mit,
00:18:21
insgesamt 14 Prozent der Besucherschaft eher gering. Das heißt,
00:18:26
dass auch mit den Touristen kaum Kirchen distanzierte oder Ferne erreicht werden,
00:18:30
sondern primär mehr oder weniger stark, aber immer noch religiös geprägte Menschen.
00:18:38
Dies ist wichtig zu sehen, weil sich die Programmatik
00:18:44
der City-Kirchen, damit eben auch nur teilweise einlöst.
00:18:49
Und weil die Erklärung der kollektiven Bedeutungszuschreibung, wie wir sie gesehen haben,
00:18:53
womöglich weniger auf die Eigenwirkung des Kirchengebäudes zurückzuführen, ist,
00:18:58
als vielmehr mit dem hohen Grad der Religiosität der Besucherschaft zusammenhängt.
00:19:04
Dafür spricht auch, dass es einen stabilen Zusammenhang gibt,
00:19:09
zwischen den Religiositätstypen und der Wirksamkeit des Gebäudes,
00:19:13
wie man hier sieht und auch erwarten würde,
00:19:15
schätzen die A-religiösen ganz links zu sehen,
00:19:19
die Wirkungen des Raumes am geringsten ein,
00:19:22
die religiösen ganz rechts zu sehen,
00:19:24
am stärksten
00:19:29
Daraus kann man schließen, dass Citykirchen erstens in vielfältiger Weise
00:19:34
wahrgenommen werden und damit wesentlich zur kirchlichen Profilierung beitragen.
00:19:39
Allerdings weniger dadurch, dass sie neue Kirchen distanzierte Besucherkreise erschließen würden,
00:19:46
als vielmehr durch die Stabilisierung derer,
00:19:49
die der Kirche ohnehin verbunden sind. Und zweitens,
00:19:53
dass hierfür die Reinszenierung des Gebäudes als öffentlicher Raum zentral ist,
00:19:59
der allerdings nicht aus sich heraus wirkt,
00:20:01
sondern auf die religiöse Prägung und Resonanz
00:20:03
der BesucherInnen
00:20:05
angewiesen ist
00:20:07
Ich komme zu meinem zweiten empirischen Fall, und zwar
00:20:12
die Transformation der ehemaligen Caperna-Umkirche in die Al-Nur-Moschee in Hamburg.
00:20:19
In diesem Fall geht es primär um die Beziehungen zwischen den beiden beteiligten Religionsgemeinschaften,
00:20:26
die evangelische Kirche und die muslimische Gemeinde,
00:20:28
aber ebenso um ihre Positionierung und Anerkennung auch in der Gesellschaft.
00:20:34
Auch hier interessierte wieder die Frage, wie dieser Raum geschaffen wird,
00:20:38
welchen Anteil daran das Materielle hat und welche Wirkungen davon ausgehen.
00:20:44
Zum Hintergrund Die Capernaumkirche wurde seit 1901 von einer evangelisch-lutherischen Gemeinde betrieben,
00:20:52
die wegen Mitglieder-Rückgangsfusionierte und in 2002 aus der Kirche auszog.
00:20:59
Das Kirchengebäude wurde daraufhin entwidmet und im Jahr 2005 an einen Investorverkauf,
00:21:05
der darin eine Kindertagesstätte plant, der hier auch nicht realisierte,
00:21:08
sodass das Gebäude hier rechts zu sehen, Leerstand und über die Jahre hinweg verfiel.
00:21:17
Die muslimische All-Nor-Gemeinde ist seit 1993 in Hamburg ansässig und untergebracht
00:21:25
in einer ehemaligen Tiefgarage
00:21:29
Diese wurde für die wachsende Gemeinde von damals 2.500 Angehörigen zunehmend zu klein.
00:21:36
Und in 2012 kaufte sie daher die Kapernaumkirche nicht von der Kirche,
00:21:42
sondern vom Investor, um sie zur Moschee umzuwandeln.
00:21:47
Für diese, für die Kirche war dies insofern brisant,
00:21:53
als sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche in ihren Rechtsverordnungen festlegen,
00:21:57
dass ihre Gebäude prinzipiell bei anderen christlichen oder jüdischen Gemeinden
00:22:01
übergeben werden können,
00:22:03
nicht jedoch muslimischen oder anderen
00:22:05
nicht-christlichen Gemeinschaften
00:22:09
Entsprechend groß war die Aufregung und es gab unmittelbar nach dem
00:22:13
Kauf in 2013 heftige Reaktionen der Kirchenverantwortlichen hier nur einige Zitate,
00:22:19
die Umnutzung in eine Moschee sei ein Missgeschick,
00:22:21
ein Darmbruch und man hätte die Kirche besser abreißen sollen,
00:22:23
als eine Nutzung durch Muslime zu ermöglichen.
00:22:27
Fünf Jahre später bei der Eröffnung der Moscheen 2018 war davon nicht mehr die Rede,
00:22:33
allerdings auch weniger von einer Moschee als vielmehr von einem,
00:22:37
ich zitiere interreligiösem Projekt,
00:22:39
einem leuchtenden Beispiel interreligiöser Offenheit,
00:22:42
einer Brücke zwischen Christentum und Islam und der interreligiösesten Begegnungsstätte Deutschlands
00:22:49
Diskurs analytisch kann man also sagen, diese Kirchenmoschee,
00:22:52
Umnutzung funktionierte oftmals wesentlich über ihre Deutung als interreligiöser Raum.
00:22:59
Die interessante Frage ist nun, wie kam es dazu?
00:23:03
Dies lässt sich zurückführen auf vielfältige Faktoren, wie insbesondere darauf,
00:23:07
dass sich die ehemalige evangelische Kirchengemeinde nicht den anfänglichen Deutung und der Kirchenverantwortlichen anschloss,
00:23:15
sondern sich hinter dir nur Gemeinde stellte und beide Gemeinden den Umnutzungsprozess gemeinsam gestalteten.
00:23:21
Neben diesen und weiteren rechtlichen sozialen kontextuellen Faktoren spielte ebenso
00:23:28
Und dies will ich exemplarisch an drei Punkten zeigen,
00:23:31
die räumlich materielle Gestaltung, eine entscheidende Rolle.
00:23:36
So war erstens von zentraler Bedeutung, dass das Äußere
00:23:40
des Kirchengebäudes weitgehend unverändert blieb, wie hier zu sehen.
00:23:44
Links noch als Kirche, rechts als Moschee im Entwurf.
00:23:48
Zwar waren schon faktisch durch den Denkmalschutz nur wenige Änderungen am Gebäude überhaupt möglich,
00:23:56
deutungswirksam aber wahr, dass dies auch diskursiv geframed wurde,
00:24:00
indem die Moscheegemeinde erklärte,
00:24:02
man wolle mit der Umnutzung auch eine denkmalgeschützte Kirche erhalten und
00:24:06
die Umgestaltung folge daher dem Motto,
00:24:09
Außenkirche innen Moschee
00:24:12
Dies erklärte der Vorsitzende der Moschee-Gemeinde in zahlreichen Interviews bezeichnenderweise bereits von Beginn an,
00:24:20
sodass dies nicht etwa das Ergebnis von Außenhandlungsprozessen war,
00:24:24
sondern sich hierrin eher die antizipierte Erwartungshaltung gegenüber der Moschee-Gemeinde ausdrückte.
00:24:32
Dies galt am Ende des Bauprozesses schließlich auch für das Kreuz auf dem Dach des ehemaligen Kirchturms,
00:24:38
das hier zu sehen, nicht durch einen Halbmond,
00:24:41
sondern durch den Schriftzug Alar als arabisches Wort für Gott ersetzt wurde,
00:24:46
da man so erklärte,
00:24:47
der Vorsitzende,
00:24:48
Zitat,
00:24:49
keine Differenzierungssymbole fördern wolle
00:24:54
Zweitens hat man im Inneren des Gebäudes zum einen christliche Elemente erhalten,
00:24:59
wie etwa hier in direkter Verlängerung des Geländers zu sehen oder vielleicht zu erahnen,
00:25:04
ein goldenes Kreuz in den denkmalgeschützten Bundglasfenstern.
00:25:10
Zum anderen hat man auch verbindende Elemente neu geschaffen,
00:25:14
wie etwa eine Kalligrafie der Suche Maria aus dem Koran
00:25:18
als Zeichen ihrer gemeinsamen Verehrung im Islam wie im Christentum.
00:25:23
Diese Kalligrafie ziert eine Empore hier zu sehen,
00:25:26
die den Frauen zum Gebet vorbehalten und nach ihren Wünschen gestaltet worden sei,
00:25:32
so der Vorsitzende, der dies in einem Interview kommentiert,
00:25:34
Zitat,
00:25:35
so können die Frauen auf ihre Männer hinabsehen,
00:25:37
die Männer müssen zu ihren Frauen aufsehen
00:25:41
Und drittens, materialisiert sich dieser Prozess der Umnutzung wiederum in Formen der Re-Materialisierung,
00:25:49
mit denen die Deutung als interreligiöser Raum festgeschrieben wird.
00:25:53
So ist zum Beispiel in Kooperation der Evangelischen Kirche und der Moschee-Gemeinde
00:25:57
ein Material für den schulischen Religionsunterricht entstanden, hier links zu sehen,
00:26:02
indem die Umnutzung, so heißt es darin,
00:26:04
als ein Zitat auf Dialog hin konzipierter Lernort vermittelt wird.
00:26:10
Ein zweites Beispiel ist eine umfangreiche, multimediale Dokumentation,
00:26:14
die entstanden ist auf Initiative eines Angehörigen, der All-Nur-Gemeinde,
00:26:20
der hier für den Auftrag und die Finanzierung von der evangelischen Kirche bekam und in einem Interview erklärt,
00:26:25
Zitat, gerade dass ein Muslim für die evangelische Kirche ein Projekt realisiert,
00:26:30
dass eine Kirche zu einer Moschee umgebaut wird,
00:26:32
ist maximal interreligiös und ein ideales Beispiel für gemeinsames Zusammenleben.
00:26:38
Beide Dokumentationen erzählen die Geschichte der Umnutzung seit der Entstehung der Capernaumkirche
00:26:44
und stellen Sie damit in einen historischen Kontext- und Kommunikationszusammenhang auch über die Generationen hinweg.
00:26:51
Und ein letztes Beispiel bei der Eröffnung der Moschee verleiht schließlich die allen nur Gemeinde,
00:26:57
jetzt in der Rolle des Gebenden,
00:26:59
ein hierzu eigens angefertigten Ehrenpreis mit einem eingelassenen Bild, der ein No-Moschee,
00:27:05
der vom Vorsitzenden ganz rechts an den Staatsrat in der Mitte übergeben wird,
00:27:10
als so bezeichneter islamischer Bambi,
00:27:13
worin auch die erreichte Anerkennung und Position zum Ausdruck kommt.
00:27:20
Deutlich wird, dass die Konstituierung der Kirchenmorscheumnutzung als interreligiöser Raum für beide Religionsgemeinschaften,
00:27:27
ihre Positionierung im religiösen und im gesellschaftlichen Feld ermöglicht hat.
00:27:32
So konnte einerseits die evangelische Kirche, die Kirche Moschee,
00:27:35
Umnutzung gegenüber Mitgliedern und Öffentlichkeit als interreligiöses Projekt legitimieren,
00:27:41
und hat mit dem Verlust ihrer rechtlichen Ansprüche auf das Gebäude
00:27:45
nicht auch ihre Deutungsansprüche aufgeben müssen.
00:27:49
Denn andererseits hat die muslimische Gemeinde diese antizipiert und darauf vielfältig
00:27:55
und eben auch räumlich materiell reagiert,
00:27:58
indem sie die religiösen Differenzen in der baulichen Außengestaltung im Kern
00:28:04
durch die Nicht-Sichtbar-Werdung der Moschee sowie im Innern durch islamisch-christlich verbindende Elemente sowie auch die Adressierung der Geschlechterfrage einzuebnen versucht hat.
00:28:15
Sie hat sich dadurch selbst als interreligiöser Akteur positionieren und auch
00:28:20
öffentlich bewähren können und dadurch für die lokale Gemeinde,
00:28:24
wie auch für die städtische muslimische Gemeinschaft,
00:28:27
gesellschaftliche Anerkennung gewinnen können
00:28:30
Ich komme zum dritten Fall,
00:28:34
in dem der Dialog nun zur zentralen Intention erklärt wird.
00:28:40
Dem sogenannten House of One in Berlin, mit dem eine Kirche,
00:28:44
eine Synagoge und eine Moschee unter einem Dach entstehen und damit
00:28:50
zum interreligiösen und gesellschaftlichen Dialog beitragen soll.
00:28:54
Zu sehen sind hier links der Entwurf und rechts die drei Initiatoren,
00:29:00
Vertreter der Beteiligten evangelischen,
00:29:02
jüdischen und muslimischen Gemeinde
00:29:06
Mit dem Architekturmodell hier in den Händen auf der Baustelle,
00:29:10
wo das House of One erst noch gebaut werden soll.
00:29:15
Anders waren architektonische Ausgrabungen im Jahr 2007 und dabei freigelegte Funde von der Petri-Kirche
00:29:22
aus dem Jahr 121230 als ältester Ort der Stadt Berlin,
00:29:27
die mehrmals um- und neu gebaut und 1964 dann von der Ostdeutsch-Regierung abgerissen wurde.
00:29:35
Genau, an dieser Stelle soll nun mit Grundsteinlegung in 2021
00:29:40
in den nächsten drei Jahren keine Kirche,
00:29:43
sondern ein neuer,
00:29:45
interreligiöser Sakralbau entstehen
00:29:49
Das ist auch das Besondere an diesem Projekt,
00:29:51
denn solche Häuser der Religionen entstehen auch in anderen Städten,
00:29:55
mit dem House of One, soll aber erstmal sein interreligiöser Sakralbau entstehen,
00:30:01
der als Neukonstruktion eigens dafür geplant und gebaut wird und damit verspricht,
00:30:07
insbesondere auch durch seine Architektur wirksam zu werden.
00:30:13
Diese Idee hat auch politisches Interesse gefunden und zur Finanzierung der Baukosten von rund 47 Millionen Euro,
00:30:21
die zunächst über Spenden erfolgte,
00:30:25
wurden inzwischen erhebliche staatliche Mittel im Rahmen der Förderung des interridiösen
00:30:28
Dialogs in Höhe von 20 Millionen Euro vom Bund und weiteren 10 Millionen vom Land Berlin zugesagt,
00:30:35
womit entsprechend hohe Erwartungen an das Projekt und seine friedensstiftenden Potenziale auch von politischer Seite verbunden werden.
00:30:45
Was ich im folgenden zeigen möchte, ist,
00:30:49
dass das House of One, obwohl der Bau erst noch entsteht,
00:30:53
bereits produktive Diskurse und interreligiöse Imaginationen hervorbringt,
00:30:59
die einerseits auf soziale Prozesse zurückgehen, also Veranstaltungen,
00:31:06
Kooperationen und Netzwerke sowie deren Medialisierung, Visualisierung und Zirkulation,
00:31:12
über die verschiedenen Kommunikationskanäle.
00:31:14
Für die andererseits, gerade dessen materiellen Repräsentation von zentraler Bedeutung sind.
00:31:21
Auch hierzu drei exemplarische Punkte. So war es erstens wichtig,
00:31:26
dass das Projekt von vornherein so angelegt war,
00:31:28
dass das House of One schon im Entstehungs- und Bauprozess in
00:31:31
der Stadt wirken sollte und nicht erst nach seiner Fertigstellung.
00:31:34
Hierzu fand ein langer, gemeinsamer Planungsprozess der drei beteiligten Religionsgemeinschaften statt,
00:31:41
der sich dann erstmals manifestierte in einem gemeinsamen Auslobungstext für einen
00:31:46
sogenannten architektonischen Realisierungswettbewerb in
00:31:52
3,
00:31:53
4 wurden die Vorstellungen und Erwartungen an den Sakralbau und seiner Architektur,
00:31:58
das Material, die Archäologie, das Licht, die Technik,
00:32:01
die Eingänge und so weiter bereits sehr präzise und als Aufgabenstellung für die Architekten formuliert.
00:32:10
Gewinner dieses Wettbewerbs war der Entwurf eines Berliner Architekturbüros,
00:32:18
hier zu sehen, der leitende Architekt Wilfried Kühn,
00:32:20
der seinen Erfolg selbst darauf zurückführte,
00:32:24
wie er sagte,
00:32:25
den extrem gut geschriebenen Ausschreibungstext in einen beziehungsreichen Raum übersetzt
00:32:31
zu haben
00:32:32
Im Inneren wurden dazu drei getrennte Sakralbereiche für die Religionsgemeinschaften konzipiert,
00:32:38
mit einem vierten Zentralraum in der Mitte als der wichtigste Raum,
00:32:43
der, Zitat, nicht mehr den Institutionalisierten Religionen gehört.
00:32:48
Sondern in die Stadt wirken sollte. Und das Äußere wurde
00:32:54
als mit einem Fassadendesign verstanden als Ausdruck des Öffentlichen,
00:32:58
sollte das Verhältnis zur Stadt zum Ausdruck bringen. Während mit diesen Designstrategien,
00:33:04
das House of One sowohl in seinen baulichen Anordnungen als auch beabsichtigten Wirkungen konstruiert wird,
00:33:11
lässt sich zweitens zeigen,
00:33:13
dass insbesondere deren Materialisierung und Sichtbarwerdung in Form von Entwürfen und Zeichnungen auf dem Papier,
00:33:20
also sowohl ideell wie auch finanziell wirksam beschrieben wird.
00:33:24
So kühn in einem Interview, ich zitiere,
00:33:28
sie erzählten mir, gemeinzelt hier die drei Initiatoren,
00:33:33
dass sie drei Jahre lang an dem Konzept gearbeitet hatten,
00:33:36
es aber nicht wirklich zusammenbringen konnten.
00:33:39
Erst als sie die Architektone architektonische Form hatten,
00:33:42
begann alles einen Sinn zu ergeben.
00:33:46
Es wurde zu einem Projekt, das man wirklich kommunizieren konnte,
00:33:49
auch wenn es noch nicht gebaut war und die Mittelbeschaffung
00:33:52
wurde möglich
00:33:54
Detektur hat diese unglaubliche Fähigkeit, ein Konzept zu kristallisieren,
00:33:58
selbst auf dem Papier. Anfangs sagten alle, ja,
00:34:01
das ist eine schöne Idee. Aber,
00:34:03
und in dem Moment, in dem wir den Entwurf hatten,
00:34:06
fiel die Skepsis von uns ab und die Idee begann wirklich substant zu bekommen.
00:34:12
Während sich die Idee, also zunächst im Aufschreibungstext,
00:34:16
dann auf dem Papier und im Entwurf materialisierte und sichtbar wurde,
00:34:20
wurde das Projekt drittens auch greifbar in plastischen Repräsentationen.
00:34:25
So konzipierte das Berliner Architekturbüro einerseits den Zentralraum des künftigen House
00:34:32
of One als Holzkonstruktion fast im Maßstab eins zu eins,
00:34:37
der dann hier zu sehen als Pavillon zunächst im Rahmen des
00:34:41
Reformationsjubiläums 2017 in Wittenberg aufgebaut wurde und anschließend bis 2019 neben der Baufläche in Berlin als eine Art Labor für Informationen und Veranstaltungen genutzt wurde.
00:34:54
Während dieser Pavillon noch an den Ort gebunden war,
00:34:59
wurden andererseits zahlreiche verschiedene Modelle des House of One angefertigt,
00:35:05
von den Architekten auf internationalen Ausstellungen weltweit gezeigt wurden,
00:35:09
wie auch von den beteiligten Religionsgemeinschaften lokal in Szene gesetzt wurden
00:35:14
und durch deren mediale Zirkulation das House of One weltweite
00:35:18
Präsenz und Imaginationskraft entwickelt hat
00:35:22
Das House of One hat damit bereits vor Baubeginn Wirkung erzeugt,
00:35:27
die nicht alleine, aber doch wesentlich auf das architektonische Design und dessen materiellen Repräsentationen zurückzuführen ist.
00:35:34
Das Projekt hat damit zu Verständigungsprozessen zwischen den religiösen Partnern,
00:35:38
wie auch zu kritischen Diskursen,
00:35:40
insbesondere zu Fragen der Nicht-Repräsentation und Beteiligung geführt,
00:35:44
wie etwa zur Nähe des muslimischen Partners,
00:35:46
zur umstrittenen Gulenbewegung oder auch zur Nichtbeteiligung der vielen
00:35:51
anderen Religionsgemeinschaften in der Stadt
00:35:57
Ich komme damit zu meinem dritten und letzten Punkt und möchte
00:36:03
abschließend diese drei Fälle noch einmal zusammenfassen und systematisieren,
00:36:06
im Blick auf die leitende Frage, wie wirken religiöse Architekturen in pluralen Stadtgesellschaften?
00:36:13
Drei Erkenntnisse scheinen hierbei zentral. Erstens wurde deutlich,
00:36:19
dass religiöse Architekturen zentrale Orte von Aushandlungsprozessen,
00:36:23
sowohl Zwischenreligionsgemeinschaften als auch zwischen Religion und Gesellschaft
00:36:28
sind und damit auch handlungsorientierende Funktionen in pluralen Gesellschaften übernehmen
00:36:36
Wie es geschieht, das haben die drei Fälle gezeigt,
00:36:40
in unterschiedlicher Weise, wie es hier spaltenweise noch einmal zusammengefasst ist.
00:36:47
So stellen Citykirchen eine Form der religiösen Selbstregulierung,
00:36:53
da in dem mit der Reinszenierung des Kirchengebäudes als öffentlicher Raum,
00:36:58
eine kirchliche Profilierung in einem zunehmend säkularen Kontext verfolgt wird,
00:37:05
die sich empirisch eher als Stabilisierung erweist.
00:37:08
Die Kirchenmuscheeumnutzung führte als eine Form der interreligiösen Regulierung zu einer Positionierung beider Beteiligter Religionsgemeinschaften sowohl zueinander,
00:37:21
als auch im gesellschaftlichen Feld und über die räumliche Anpassung in
00:37:25
einem christlich dominierten Kontext zur schrittweisen Anerkennung der muslimischen Gemeinschaft.
00:37:31
Dasaus of One in Berlin begann,
00:37:34
als ein interreligiöses Projekt und entwickelte sich mit der politischen Beteiligung
00:37:38
zu einer Form der staatlich interreligiösen Regulierung zur Toleranzförderung,
00:37:43
die über das Architektonische Design interreligiöse Imagination in einer zunehmend pluralen Gesellschaft befördert hat.
00:37:52
Zweitens, wurde deutlich, wie religiöse Architekturen ihre Wirkkraft entfalten.
00:37:58
Nämlich weder allein als soziale Konstruktion noch materialistisch determiniert,
00:38:04
sondern als sozialmaterielle Konstellation. Zur Verfügung, City-Kirchen über besondere Raumqualitäten,
00:38:12
deren Anziehungskraft und Erleben auf eine kulturell religiöse Prägung angewiesen ist.
00:38:17
Bei der Kirchenmuschee-Umnutzung verbinden sich materiell diskursive Strategien und soziale Praktiken
00:38:24
zu ihrer Deutung als interreligiöser Raum.
00:38:28
Und das House of One entsteht bereits vor Baubeginn als
00:38:31
soziale Konstruktion, die auf dessen materiellen Repräsentationen basiert
00:38:38
Dies verweist drittens auf die besondere Potentialität, religiöse Architekturen,
00:38:45
die plurale Gesellschaft, affektiv und dabei auch über Zeithorizonte hinweg erfahrbar zu machen.
00:38:53
Sogar in Citykirchen, religiöse und kulturelle Zugehörigkeiten und Traditionen vermitteln oder als Erinnerungsorte zumindest wachhalten.
00:39:03
Andererseits aber auch als fremde Orte der Nicht-Zugehörigkeit empfunden werden. Kirchen-Moschee-Umnutzung können gerade diese Vertrauten,
00:39:13
für viele vertrauten Traditionen in Frage stellen und dadurch Ängste hervorrufen,
00:39:18
aber auch als besonders authentischer, pluraler Ort wahrgenommen werden.
00:39:22
Das House of One verspricht sowohl Religion als auch Zeithorizonte zu verbinden,
00:39:30
indem es auf der kirchlichen Vergangenheit, auf den kirchlichen Fundamenten
00:39:34
aufbaut und gleichzeitig eine normative Vision einer pluralen Gesellschaft entwirft.
00:39:42
Gerade also in ihrer affektiven Dimension zeigt sich damit auch die Ambivalenz religiöser Architekturen,
00:39:51
die sowohl als Ermöglichungs- wie auch als Ausschlussräume,
00:39:56
sowohl stabilisierend wie auch Desh stabilisierend auf soziale Ordnungen wirken zu können.
00:40:04
Damit wird schließlich auch deutlich, dass religiöse Räume nicht Freisinn
00:40:08
von Macht und hierarchischen Verhältnissen und sich eben nicht isoliert voneinander, sondern in Relation zueinander entwickeln.
00:40:15
Sie alle sind Ausdruck einer pluralen Welt und fordern als Resonanzräume gleichzeitig dazu auf,
00:40:21
dass Religion sich zueinander und gegenüber einer zunehmend pluralen Gesellschaft verhalten.
00:40:30
Damit komme ich zum Ende oder bin ich am Ende,
00:40:33
Sie finden hier, falls Sie nachlesen wollen,
00:40:36
einige Publikationsangaben Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe,
00:40:46
ich konnte Ihnen mit diesem Beitrag einige Einblicke in aktuelle Entwicklung,
00:40:51
wie auch Herausforderungen geben,
00:40:53
die wir sicher in den kommenden Veranstaltungen hier weiter vertiefen werden,
00:41:00
dann mit den Kolleginnen und den Referierenden.
00:41:03
Ich freue mich sehr darauf. Ich hoffe Sie dann
00:41:06
in zwei Wochen hier an dieser Stelle wiederzusehen und wünsche Ihnen
00:41:11
bis dahin eine gute Zeit und danke Ihnen